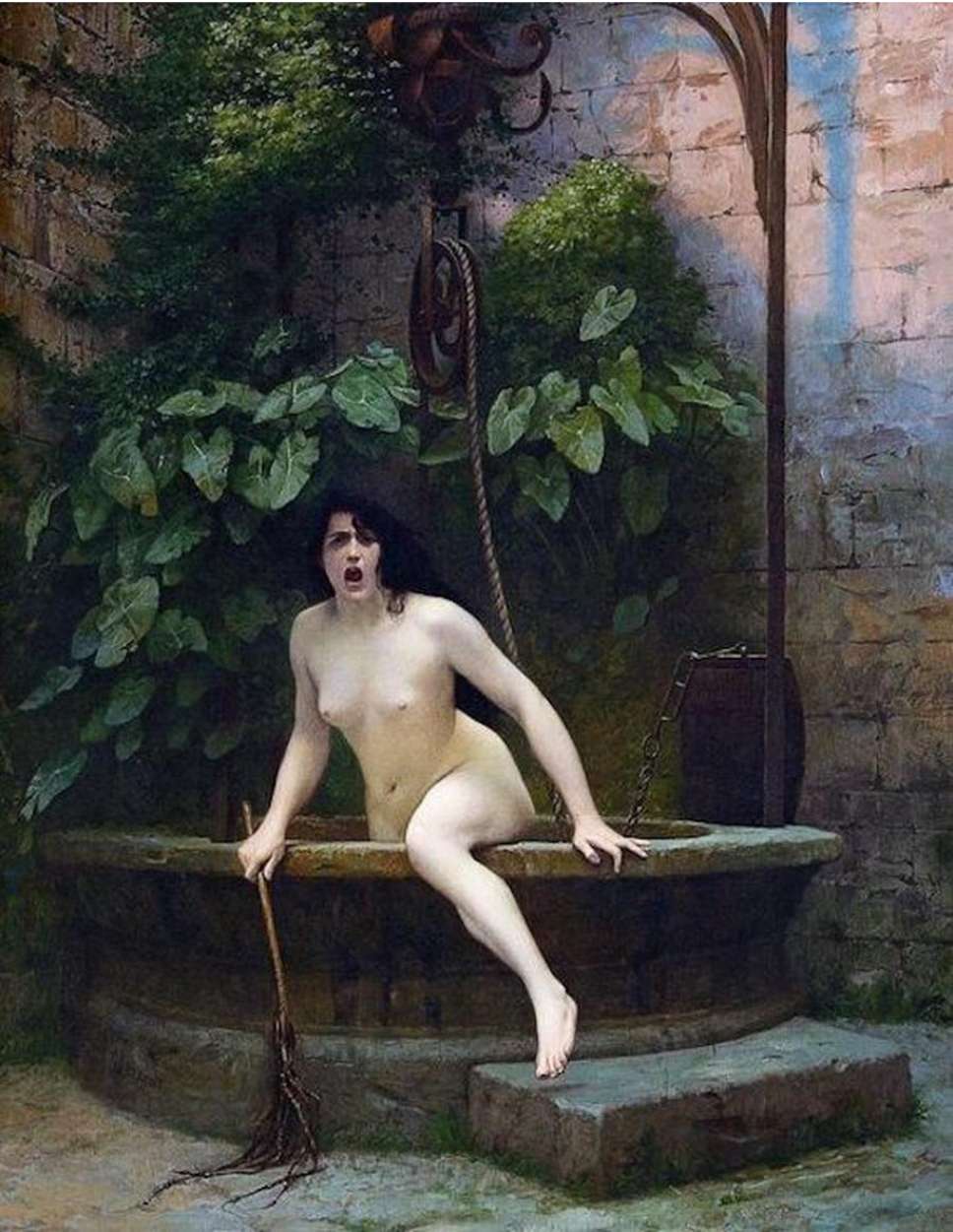Der Umverteilungsstaat und seine Folgen.
Linke und rechte Kritiker unsere politischen Systems scheinen sich in einem Punkt einig zu sein: Der Staat verteilt Vermögen um, und das ist schlecht. Während freilich die Linken ausschließlich eine Umverteilung „von unten nach oben“ anprangern, kritisieren die Rechten auch eine Umverteilung „von oben nach unten“. Wie erfolgt die Umverteilung wirklich? Und was sind die Folgen?
Zum Einstieg in das Thema habe ich die KI (Microsoft Copilot) befragt; deren Ausführungen sind im folgenden kursiv wiedergegeben:
Umverteilung von oben nach unten
Diese Form der Umverteilung zielt darauf ab, soziale Ungleichheiten zu verringern und Menschen mit geringem Einkommen zu unterstützen.
-
Progressives Steuersystem
Höhere Einkommen unterliegen einem höheren Steuersatz. Der Spitzensteuersatz liegt bei 42 %, ab einem sehr hohen Einkommen sogar bei 45 % („Reichensteuer“). -
Sozialleistungen und Transferzahlungen
Leistungen wie Bürgergeld, Wohngeld, Kindergeld oder BAföG werden aus Steuermitteln finanziert und kommen vor allem Menschen mit niedrigem Einkommen zugute. -
Gesetzliche Krankenversicherung (Solidarprinzip)
Beiträge richten sich nach dem Einkommen, aber alle Versicherten erhalten die gleichen Leistungen. Höhere Einkommen subventionieren damit die Versorgung der Geringverdiener. -
Rentenversicherung
Auch hier gilt das Umlageverfahren: Erwerbstätige zahlen ein, Rentner erhalten Leistungen – unabhängig davon, ob sie selbst genug eingezahlt haben. -
Subventionen für öffentliche Infrastruktur
Öffentliche Bildung, Nahverkehr und Kulturangebote werden staatlich gefördert und sind für alle zugänglich – besonders hilfreich für Menschen mit geringem Einkommen.
Umverteilung von unten nach oben
Diese Form der Umverteilung entsteht oft indirekt durch politische, wirtschaftliche oder strukturelle Rahmenbedingungen.
-
Regressive Verbrauchssteuern
Steuern wie die Mehrwertsteuer (19 %) belasten einkommensschwache Haushalte relativ stärker, da sie einen größeren Anteil ihres Einkommens für Konsum ausgeben.
Während die Einkommensteuer tatsächlich progressiv ist, indem die Bezieher höherer Einkommen einen höheren Prozentsatz zahlen als die Bezieher niedrigerer Einkommen, und indem jene, die am wenigsten verdienen, überhaupt keine Einkommensteuer zahlen, sind die Verbrauchssteuern keineswegs regressiv, sondern prozentual für alle gleich. Die „relativ stärkere“ Belastung kann sich zwar indirekt ergeben, ist aber letztlich eine Frage der persönlichen Lebensführung. Wenn ein Reicher sein gesamtes Einkommen ausgibt, ist er durch die Mehrwertsteuer relativ ebenso stark belastet wie ein Armer.
-
Kapitalerträge und Vermögensbesteuerung
Kapitalerträge werden pauschal mit 25 % besteuert (Abgeltungssteuer), was oft günstiger ist als der persönliche Einkommensteuersatz. Vermögen wird kaum besteuert, was Reiche begünstigt.
Auch das ist kein Argument für eine Umverteilung von unten nach oben. Im Gegenteil ist sogar die Abgeltungssteuer tendenziell progressiv, weil es Freibeträge gibt. Beispiel: Ein Alleinstehender mit 1.000 Euro Kapitalerträgen – das ist der Freibetrag – zahlt 0 % Abgeltungssteuer. Jemand mit 2.000 Euro Erträgen zahlt auf die eine Hälfte, den Freibetrag, 0 Prozent, auf die andere 25 Prozent, insgesamt also 12,5 Prozent. Je höher die Erträge sind, desto weniger wirkt sich der Freibetrag aus, und desto näher rückt man insgesamt an die 25 Prozent heran.
-
Steuerliche Schlupflöcher und Gestaltungsmöglichkeiten
Wohlhabende Personen und Unternehmen können durch Steuerberatung legale Wege finden, ihre Steuerlast zu senken – etwa durch Holdingstrukturen oder Auslandsverlagerung.
Eine Verlagerung ins Ausland mag Steuern sparen, aber das ist keine Umverteilung, sondern die Folge eines Standortwettbewerbs. Möglichkeiten, die Steuer zu mindern, gibt es auch für Normalverdiener (Freibeträge, von der Kasse nicht übernommene Krankheitskosten etc.).
-
Immobilienbesitz und Mietmärkte
Vermieter (oft mit höherem Vermögen) profitieren von steigenden Mieten und Immobilienwerten, während Mieter (häufig mit geringerem Einkommen) stärker belastet werden.
Inflation, und darum handelt es sich hier, ist keine Umverteilung. Steigende Mieten müssen keine steigenden Gewinnspannen der Vermieter bedeuten, da auch deren Kosten steigen. Letztlich ist es eine Sache von Angebot und Nachfrage. Soweit der Staat durch Mietobergrenzen oder Erhöhungsgrenzen eingreift, ist es stets zugunsten der Mieter. Selbstverständlich gibt es ein (zu) knappes Angebot an Wohnraum, aber das hat nichts mit Umverteilung zu tun, sondern mit hohen Baukosten, umständlicher Bürokratie und Massenmigration. Wäre das Bauen von Wohnraum heute noch halbwegs profitabel, würde ja mehr gebaut werden!
-
Privatisierung öffentlicher Leistungen
Wenn staatliche Leistungen (z. B. Gesundheit, Bildung, Verkehr) privatisiert werden, profitieren oft Unternehmen und Investoren – während die Kosten für Nutzer steigen.
Dass durch die Privatisierung die Kosten für die Nutzer steigen, ist ein Trugschluss. Wenn der Staat Leistungen günstiger anbietet als ein Privatunternehmen, dann schlicht deshalb, weil ein Teil der Kosten quasi unbemerkt über Steuern und Abgaben finanziert wird. Im allgemeinen arbeitet der Staat aber so ineffektiv, insbesondere wenn er ein Monopol besitzt, dass Verbraucher bei privaten Anbietern günstiger wegkommen. Man denke nur daran, wie viel ein Ferngespräch kostete, als der Staat noch das Telekommunikationsmonopol besaß! Schließlich hat der Gedanke, dass Unternehmen und Investoren profitieren, auch nichts mit Umverteilung zu tun, denn sie verkaufen ein Produkt oder eine Dienstleistung. Investieren durch Käufe von Aktien oder Anleihen kann auch ein Kleinanleger.
Die KI konnte – oder „wollte“ dank ihrer Programmierung – also keinen einzigen (stichhaltigen) Beleg für eine Umverteilung von unten nach oben vorlegen! Oder anders ausgedrückt: Sie bezeichnete staatliche Maßnahmen als Umverteilung von unten nach oben, auf die das nicht zutrifft. Liegen demnach die Kritiker von links völlig daneben?
Nicht ganz; es gibt tatsächlich Argumente für eine Umverteilung von unten nach oben, aber die wurden von der KI verschwiegen.
Direkte vs. indirekte Umverteilung
„Umverteilung“ im politischen Sinn kann auf zweierlei Weise stattfinden: direkt oder indirekt. Die KI hat das bereits angedeutet, indem sie sagte, die Umverteilung von unten nach oben entstehe „oft indirekt durch politische, wirtschaftliche oder strukturelle Rahmenbedingungen“, auch wenn die Beispiele unzutreffend waren.
Bei der direkten Umverteilung zieht der Staat durch Steuern und Abgaben Eigentum ein und zahlt es durch Sozialleistungen (einschließlich der staatlichen Versicherungen) aus. Dabei gibt es Menschen, die mehr zahlen als sie zurückerhalten, und andere, die mehr erhalten als sie bezahlen.
Diese – Milliarden an Verwaltungskosten verschlingende – Art der Umverteilung existiert ausschließlich mit dem Ziel, die Lebensverhältnisse der Menschen anzugleichen und ist daher die klassische Umverteilung von Reicheren zu Ärmeren, also „von oben nach unten“. In Deutschland wird sie durch den Länderfinanzausgleich noch verstärkt, indem nämlich Länder mit überdurchschnittlichen Steuereinnahmen (derzeit lediglich Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und Hamburg) Geld an Länder mit unterdurchschnittlichen Steuereinnahmen überweisen müssen. Zusätzlich zahlt der Bund aus dem gesamtdeutschen Steuertopf einen Anteil.
Die indirekte Umverteilung besteht aus staatlichen Eingriffen in den Markt, die Geldflüsse zur Folge haben, die es ohne diese Eingriffe nicht gäbe. Auch hier gibt es somit Benachteiligte und Begünstigte, und der Staat ist dabei sehr erfinderisch.
Bei dieser indirekten Umverteilung gehen die Geldflüsse zwar ebenfalls manchmal „von oben nach unten“, aber es kann auch umgekehrt sein.
Da ist zunächst die Unterstützung maroder Unternehmen durch günstige oder gar zinslose Kredite, deren Risiko der Steuerzahler trägt. Im Extremfall werden sogar Steuergelder verschenkt wie bei der „Bankenrettung“ im Zuge der Finanzkrise 2008. In welche Richtung diese Umverteilung geht, ist dabei gar nicht so leicht zu sagen. Immerhin stehen die betroffenen Unternehmen vor der Insolvenz und werden durch Steuergelder unterstützt bzw. gerettet, die von florierenden Unternehmen sowie von steuerpflichtigen und damit nicht ganz armen Bürgern stammen. Wenn insbesondere bei der Bankenrettung von einer Umverteilung „von unten nach oben“ gesprochen, wird, so wohl deshalb, weil Banken mit Reichtum assoziiert werden. Alleine, wenn Banken überschuldet sind, sind sie eben nicht mehr reich. Linke würden nun argumentieren, dass das Vermögen der Anleger gerettet wurde; aber auch die sind – zumal nach dem Verlust – nicht alle reich. Wohlgemerkt: Damit will ich die Sozialisierung der Bankschulden nicht rechtfertigen, sondern nur feststellen, dass sie zwar eine Umverteilung ist, aber nicht zwingend „von unten nach oben“. Dass die Banken ihre Lage durch riskante Geschäfte selbst verschuldet haben, steht auf einem anderen Blatt – schließlich haben auch viele Empfänger von Bürgergeld ihre Lage selbst verschuldet. Nach der Ursache für Armut fragt der Staat normalerweise nicht, wenn er Steuergelder verteilt.
Während diese Art der Unterstützung also das Ziel hat, arm gewordenen Unternehmen oder Banken zu helfen, hat eine andere Art politische und ideologische Ziele; nämlich dann, wenn der Staat bestimmte Geschäfte fördern oder behindern will. Allen voran ist das die „Energiewende“, die Billionen Euro zu Unternehmen umverteilt, die ohne diese Gelder nicht lukrativ arbeiten könnten. Die Kunden erhalten zwar eine Gegenleistung – Energie –, aber sie bezahlen dafür mehr als es in einem freien Markt der Fall wäre, bei dem sich die effizientesten Energieträger und Firmen durchsetzen würden. Das ist also eine Umverteilung von Bürgern zu Unternehmen, gewissermaßen „von unten nach oben“. Das perfide daran ist, dass die Bürger zwar ärmer werden, aber die Unternehmen nicht reicher als sie es wären, wenn sie effiziente Energieformen produzieren würden. Die Energiewende ist insofern nicht nur eine Umverteilung, sondern viel mehr noch eine Vernichtung von Steuergeld!
Neben solchen Geschenken für Unternehmen gibt es eine weitere Möglichkeit, die Kosten für die Verbraucher zu erhöhen: „Straf“steuern wie die Kraftstoffsteuer, die Tabaksteuer oder die Vergnügungssteuer; umverteilt wird dabei vom Bürger zum Staat; zu bewerten ist das ähnlich wie die Mehrwertsteuer. In welche Richtung die Umverteilung erfolgt, hinge letztlich von der Verwendung des Geldes ab. Steuern kommen jedoch in einen großen Topf und sind nicht zweckgebunden.
Eine andere Methode der indirekten Umverteilung ist der Kauf- oder Abnahmezwang. Hier schreibt der Staat vor, dass der Bürger bestimmte Dienstleistungen oder Produkte beziehen muss, die er freiwillig in vielen Fällen nicht in Anspruch nehmen würde: Versicherungen, Rundfunkgebühr, Führerschein, Fahrzeuginspektion, Rauchmelder, Kindersitze ... Zum Äußersten getrieben wurde das während der Corona-„Pandemie“: „Impf“stoffe und Schutzmasken wurden für hunderte Milliarden Steuergelder angeschafft und vieles davon wieder vernichtet. Die „Impf“stoffe haben zudem mehr Schaden als Nutzen angerichtet. Das war wohl die größte Umverteilung von unten nach oben, die es je innerhalb so kurzer Zeit gegeben hat. Nun sind nach den Pharmafirmen die Rüstungsfirmen an der Reihe, sich durch staatliche Aufträge eine goldene Nase zu verdienen. Bis zur nächsten „Pandemie“ ...
Weiterhin gibt es staatliche Gebührenordnungen wie für Ärzte und Rechtsanwälte. In welche Richtung diese Art von Umverteilung geht, ist wiederum schwierig zu sagen. Es hängt davon ab, wie die Preise auf einem freien Markt wären. Vermutlich aber wären sie niedriger, und dann könnten wir tatsächlich tendenziell von einer Umverteilung von unten nach oben sprechen, da die Nutznießer dieser Gebühren meist zu den Gutverdienern gehören.
Mit solchen Eingriffen verwandt sind Mindestlohn und „Mietendeckel“; hier handelt es sich freilich um eine Umverteilung von oben nach unten, denn wären marktgerechte Löhne nicht niedriger bzw. marktgerechte Mieten nicht höher, wären diese Maßnahmen sinnlos. Man sollte nicht vergessen, dass der Staat, der sich damit als Wohltäter geriert, im Grunde nur seine eigenen Fehler auf Kosten der Arbeitgeber bzw. Vermieter zu korrigieren versucht: Wären die Sozialabgaben niedriger und gäbe es weniger bürokratische Auflagen, könnten die Arbeitgeber höhere Löhne zahlen; und hätte nicht die staatlich geduldete, ja geförderte Massenzuwanderung Angebot und Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt dramatisch verschoben, wären die Mieten niedriger.
Ja, der Staat als solcher mit seiner Verwaltung und Bürokratie ist sogar selbst ein gewaltiges Umverteilungsprogramm! Zwar schafft er damit Arbeitsplätze, doch die sind häufig nicht produktiv. Ebensogut könnte er Menschen dafür bezahlen, dass sie Häuser einreißen und unverändert wieder aufbauen, oder dafür, dass sie acht Stunden am Tag im Kreis laufen. Diese Kosten werden von allen Steuerzahlern erbracht, aber es profitieren nur jene, die dadurch einen Arbeitsplatz erhalten. In welche Richtung die Umverteilung dabei geht, ist schwer zu sagen, da die Begünstigten keine homogene Gruppe darstellen, und die sie finanzierenden Steuerzahler noch weniger. Unterm Strich ist es, wie die „Energiewende“, eine sinnlose Vernichtung von Werten, da ein solcher Wasserkopf von Verwaltung in einer freiheitlichen Gesellschaft schlicht überflüssig wäre.
Kapitalismuskritik
Aber zurück zur Kritik der Linken an der Umverteilung von unten nach oben, die häufig als Bestandteil der „Kapitalismuskritik“ gesehen wird. Fragen wir noch einmal die KI, und zwar, wie „Kapitalismus“ definiert wird. Sie nennt als „grundlegende Prinzipien“:
Privateigentum an Produktionsmitteln: Fabriken, Maschinen, Rohstoffe und Kapital gehören Privatpersonen oder Unternehmen, nicht dem Staat.
-
Marktwirtschaftliche Steuerung: Angebot und Nachfrage regeln Produktion, Preise und Konsum – der Markt ist das zentrale Koordinationsinstrument.
-
Gewinnorientierung: Unternehmen handeln mit dem Ziel, Profit zu erzielen und Kapital zu vermehren.
-
Freie Lohnarbeit: Menschen verkaufen ihre Arbeitskraft auf dem Arbeitsmarkt, meist ohne Eigentum an Produktionsmitteln.
-
Kapitalakkumulation: Reinvestition von Gewinnen zur Expansion und Effizienzsteigerung ist ein zentrales Prinzip.
Da sich die KI auf Wikipedia und die Bundeszentrale für politische Bildung beruft, können wir diese Prinzipien wohl als zutreffend gelten lassen. Doch merken Sie etwas? Mit Umverteilung, geschweige denn einer solchen „von unten nach oben“ hat das alles nichts zu tun. Der Staat ist als Akteur in dieser Definition nicht existent! Staatliche Eingriffe wären demnach per se antikapitalistisch, weil sie den Markt behindern und die aus diesem entstehenden Kapitalflüsse umleiten. Wenn Unternehmen Kapital akkumulieren, weil ihre Produkte und Dienstleistungen freiwillig von Kunden erworben werden, also Geld gegen Leistung bzw. Produkt, dann kann man nicht von Umverteilung sprechen, die stets unfreiwillig erfolgt und die Menschen in Beraubte und Beschenkte aufteilt. Eine freiwillige Transaktion, sofern sie ohne Betrug verläuft, kennt keine Begünstigten und Benachteiligten – oder vielleicht sogar nur Begünstigte, denn würden die Akteure nicht meinen, sich durch die Transaktion besser als vorher zu stellen, würden sie diese nicht durchführen.
Welche Art der Umverteilung überwiegt?
Wie wir gesehen haben, gibt es in Deutschland beides: Umverteilung von oben nach unten, aber auch von unten nach oben. Doch was überwiegt?
Bei der Berechnung müssten zahlreiche Faktoren berücksichtigt werden; es ist um so komplizierter als sich, wie oben gesehen, viele Umverteilungsmechanismen nicht eindeutig in das Oben-unten-Schema pressen lassen. Wenn man freilich bedenkt, dass im aktuellen Bundeshaushalt (2025) 40 Prozent für Sozialleistungen einschließlich Gesundheitskosten vorgesehen sind (d.h. zusätzlich zum beitragsfinanzierten Anteil!), während sich die oben genannten Subventionen und Kredite für Unternehmen unter den 18 % „sonstigen“ Ausgaben verbergen, wird deutlich, dass in der Summe offensichtlich eine Umverteilung von oben nach unten stattfindet. Zudem befindet sich unter jenen 18 % die Entwicklungshilfe, die Geld in andere, vermeintlich ärmere Länder umverteilt, was also wiederum eine Umverteilung von oben nach unten darstellt – wobei böse Zungen allerdings das Gegenteil behaupten, nämlich dass dabei armen Leuten in reichen Ländern Geld gestohlen wird, um es reichen Leuten in armen Ländern zu geben ...
Und nicht zu vergessen ist ja schon der Staatshaushalt als solcher aufgrund der progressiven Einkommensteuer durch indirekte Umverteilung von oben nach unten generiert worden!
Bezieht man alle Steuerarten ein (auch Arme zahlen Konsumsteuern), so scheint sich nach dieser Quelle die Zahl der Nettoempfänger und der Nettozahler ungefähr die Waage zu halten. Freilich ist das nicht die sprichwörtliche Waage der Gerechtigkeit, denn egal wie das Verhältnis ist: Die einen werden bestohlen, die anderen beschenkt. Die Anzahl derjenigen, die einen ihren Steuern und Abgaben relativ genau entsprechenden Gegenwert erhalten, dürfte äußerst gering sein. Im Grunde ist jede Ausgabe des Staates eine Umverteilung. Dabei ist es aufgrund der vielen Milliarden, die jedes Jahr ins Ausland fließen (EU, Ukraine, Entwicklungshilfe, WHO) nicht einmal ein Nullsummenspiel. In der Summe erhalten die deutschen Steuer- und Abgabenzahler weniger zurück als ihren abgenommen wird!
Was bei dieser Rechnung noch nicht berücksichtigt ist, sind die enormen Schulden, mit denen der Wohlfahrtsstaat finanziert wird! Die aus dieser künstlichen Geldvermehrung resultierende Inflation trifft zwar prozentual alle gleich, aber absolut gesehen verlieren Wohlhabende dadurch natürlich mehr an Kaufkraft. Und die Zinsen werden aufgrund der progressiven Besteuerung ebenfalls hauptsächlich von den Wohlhabenderen bezahlt. Wenn das System irgendwann zusammenbricht, werden vor allem die Reichen dafür geradestehen müssen: Wer mehr hat, wird mehr verlieren. Nicht umsonst ist die staatliche Garantie der Spareinlagen nicht in Prozent festgelegt, sondern auf absolut 100.000 Euro pro Kontoinhaber und Bank begrenzt – theoretisch. Bei einem Zusammenbruch des Finanzsystems wird selbst dieser Betrag nicht garantiert sein. Somit sorgt ein wirtschaftlicher Zusammenbruch stets dafür, dass die von linker Seite viel kritisierte „Schere zwischen Arm und Reich“ kleiner wird – wohl auch deshalb tun Sozialisten alles, um einen solchen Zusammenbruch zu provozieren.
Exkurs: Sozialstaat vs. Wohlfahrtsstaat
Was ist der Unterschied zwischen Sozialstaat und Wohlfahrtsstaat? Man könnte letzteren als übersteigerte Form des ersteren bezeichnen, aber wo soll man die Grenze ziehen? Ich schlage folgende Definition vor:
Ein Sozialstaat bietet staatliche Sozialversicherungen z.B. gegen Arbeitslosigkeit, Krankheit oder für die Rente an und finanziert sie aus den eingezogenen Beiträgen. Normalerweise geschieht das durch Zwang, d.h. die Bürger haben nicht die Möglichkeit, sich (ausschließlich) privat zu versichern oder ganz darauf zu verzichten.
Ein Wohlfahrtsstaat bietet diese Versicherungen ebenfalls an, bezuschusst sie aber darüber hinaus mit Steuergeldern und/oder bezahlt Sozialleistungen sogar an Personen, die nie in eine entsprechende Versicherung eingezahlt haben, wie Zuwanderer oder solche, die von der Schule oder dem Studium direkt in die Arbeitslosigkeit wechseln.
Während also der Sozialstaat nach dieser Definition zwar umverteilt, aber nie mehr ausgibt als er durch die Beiträge einnimmt, bleibt er ohne Schulden finanzierbar. Dies dürfte der „soziale Bundesstaat“ sein, der den Vätern und Müttern des Grundgesetzes in Art. 20 vorschwebte. Abgesehen von seinem Zwangscharakter ist er aber auch sonst keineswegs unproblematisch: Die Menschen versuchen natürlich, so viel wie möglich herauszuholen, bisweilen auch mit betrügerischen Mitteln, und so entsteht ein Teufelskreis höherer Ausgaben und steigender Beiträge. Da immer höhere Beiträge irgendwann nicht mehr vermittelbar sind, beginnt die Politik, die Sozialversicherungen aus dem Steuertopf zu bezuschussen. So wird aus dem Sozialstaat ein Wohlfahrtsstaat, und die Umverteilung von oben nach unten wird noch gesteigert. Verbindet sich das mit Unterstützung für Personen, die keine Einzahler sind – eine Pervertierung des Solidaritätsgedankens –, geraten die Kosten völlig aus dem Ruder, und die Umverteilung ist nur noch durch Schulden finanzierbar. Natürlich kann das auf Dauer nicht tragfähig sein, aber für Politiker, denen es nur auf ihre Macht in der nächsten Legislaturperiode ankommt, ist es eine willkommene Form der Wählerbestechung. Werden auf diese Weise auch Zuwanderer alimentiert, die doch gar nicht wahlberechtigt sind, so hat das andere Gründe, die hier nicht weiter ausgeführt werden sollen. Doch immerhin werden viele von ihnen früher oder später eingebürgert und es ihren Wohltätern dann hoffentlich durch das Kreuz an der richtigen Stelle danken.
Weniger Armut durch Umverteilung?
Die Behauptung, Umverteilung würde Armut entgegenwirken, ist nur auf den ersten Blick einleuchtend. Sozialisten scheinen zu glauben, es gäbe einen in seiner Größe festgelegten „Kuchen“, den es zu verteilen gelte, und zwar möglichst gleichmäßig, unabhängig davon, wer ihn gebacken oder seine Zutaten bezahlt hat. Dabei übersehen sie, dass ein um so kleinerer Kuchen gebacken wird, je mehr der Staat in den Markt eingreift, und je mehr er umverteilt, denn das bestraft Leistung und belohnt Müßiggang. Die Folge ist logischerweise, dass weniger geleistet wird und es sich viele Leute in der sozialen Hängematte bequem machen: Warum sollte ich beim Kuchenbacken helfen oder einen Anteil an den Zutaten bezahlen, wenn ich sowieso ein Stück bekomme? Zusätzlich verlassen viele Leistungsträger das Land, während Unqualifizierte und Faule einwandern – sie werden ja trotzdem versorgt. Wird somit weniger produziert, sinken die Steuereinnahmen und es kann weniger verteilt werden; zudem steigen die Preise und die Kaufkraft sinkt.
Die Effektivität des freien Marktes liegt darin, dass jeder Akteur seine Interessen verfolgt und dadurch der optimale Ausgleich geschaffen wird. Der Staat bzw. die Politiker und Beamten treffen ihre Entscheidungen notwendigerweise für ganze Gruppen oder sogar für die gesamte Bevölkerung, scheren also alles über einen Kamm. Die Trägheit des Staatsapparates sorgt zudem dafür, dass Fehlentwicklungen zu spät korrigiert werden – oder überhaupt nicht, weil man sich die Fehler nicht eingestehen will. Da wird trotz Warnungen an der Maut festgehalten, bis sie von der EU verboten wird (Millionenschaden); da werden „Impf“stoffe und Schutzmasken bestellt, die niemand braucht (Milliardenschaden); da wird eine „Energiewende“ durchgezogen, die Deutschland deindustrialisiert, ohne eine sichere Energieversorgung zu garantieren und ohne das (selbst schon sinnlose) Ziel der „Klimaneutralität“ zu erreichen (Billionenschaden); da wird eine massenhafte Zuwanderung hingenommen, trotz steigender Kriminalität, Islamisierung und Überlastung der Sozialsysteme und des Wohnungsmarktes (wiederum ein Billionenschaden).
Die Kritiker der aktuellen Politik von rechts und links haben beide in Teilen recht; doch jene mehr als diese. In der Summe überwiegt die Umverteilung von oben nach unten, aber durch marktverzerrende staatliche Maßnahmen werden bestimmte Industrien und Personengruppen begünstigt und können sich auf Kosten der Bürger bereichern. Beide Arten der Umverteilung sind ungerecht und vermindern den Wohlstand.
Die Linken befinden sich freilich im Irrtum, wenn sie den Kapitalismus als das Problem ansehen. Das Problem ist im Gegenteil die Anmaßung des Staates, es besser zu können als der freie Markt, der durch Ausgleich der Interessen das Optimum an Wohlstand schafft. Auch wenn es eine völlig freie Marktwirtschaft nirgends gibt, kann der Praxistest insofern längst als bestanden gelten als eine deutliche Korrelation zwischen der relativen Freiheit der Wirtschaft und dem Wohlstand eines Landes besteht. Neuerdings bestätigt insbesondere die Politik Javier Mileis in Argentinien dieses ökonomische Gesetz.
Deutschlands Irrweg
Deutschland hat sich entgegen jener Erfahrungen ausgerechnet nach dem Zusammenbruch des Sozialismus in Osteuropa dazu entschieden, diesen Irrweg nochmals zu gehen. Nicht durch eine plötzliche Revolution, sondern durch die sozialistische Unterwanderung insbesondere der CDU/CSU und die allmähliche Gewöhnung der Bürger an immer mehr staatliche Einmischung und den Verlust von Freiheit. Dieser Kurs wird von der schwarz-roten Regierung unter Friedrich Merz, trotz gegenteiliger Versprechungen im Wahlkampf, fortgesetzt. Die Verachtung, die der Bundeskanzler gegenüber Javier Milei geäußert hat, entlarvt ihn als würdigen Nachfolger der verkappten Kommunistin Angela Merkel.
Ein freier Markt ist schlecht für Politiker, die nicht Diener des Volkes, sondern seine Beherrscher sein wollen. Die meisten Politiker ergreifen diesen Beruf aber genau deshalb: weil sie Macht ausüben möchten. Wenn der Abbau von Wohlstand gestoppt werden soll, muss also diese Macht erheblich eingeschränkt werden.
Gerade weil die Politik mehrheitlich von oben nach unten umverteilt und damit falsche Anreize setzt, verringert sie den Wohlstand und schadet letztlich allen Bürgern. Aber auch die Umverteilung von unten nach oben durch Begünstigung bestimmter Unternehmen oder Technologien ist ein Schaden für die Allgemeinheit. Wenn dann noch Dummheit (oder vorsätzlicher Zerstörungswille?) hinzukommt wie bei der Abschaltung der Kernkraft – um so schlimmer!
Wer wirklich Armut bekämpfen, will, der muss sich für den freien Markt und für ein Ende des Wohlfahrtsstaates einsetzen. Umverteilung ist nicht nur ungerecht, da sie das Recht auf Eigentum verletzt, sie erreicht nicht einmal das, was ihre Propagandisten vorgeblich bezwecken. Sie lindert Armut nicht, sondern vermehrt sie. Umverteilung ist von Übel, egal in welche Richtung sie erfolgt.