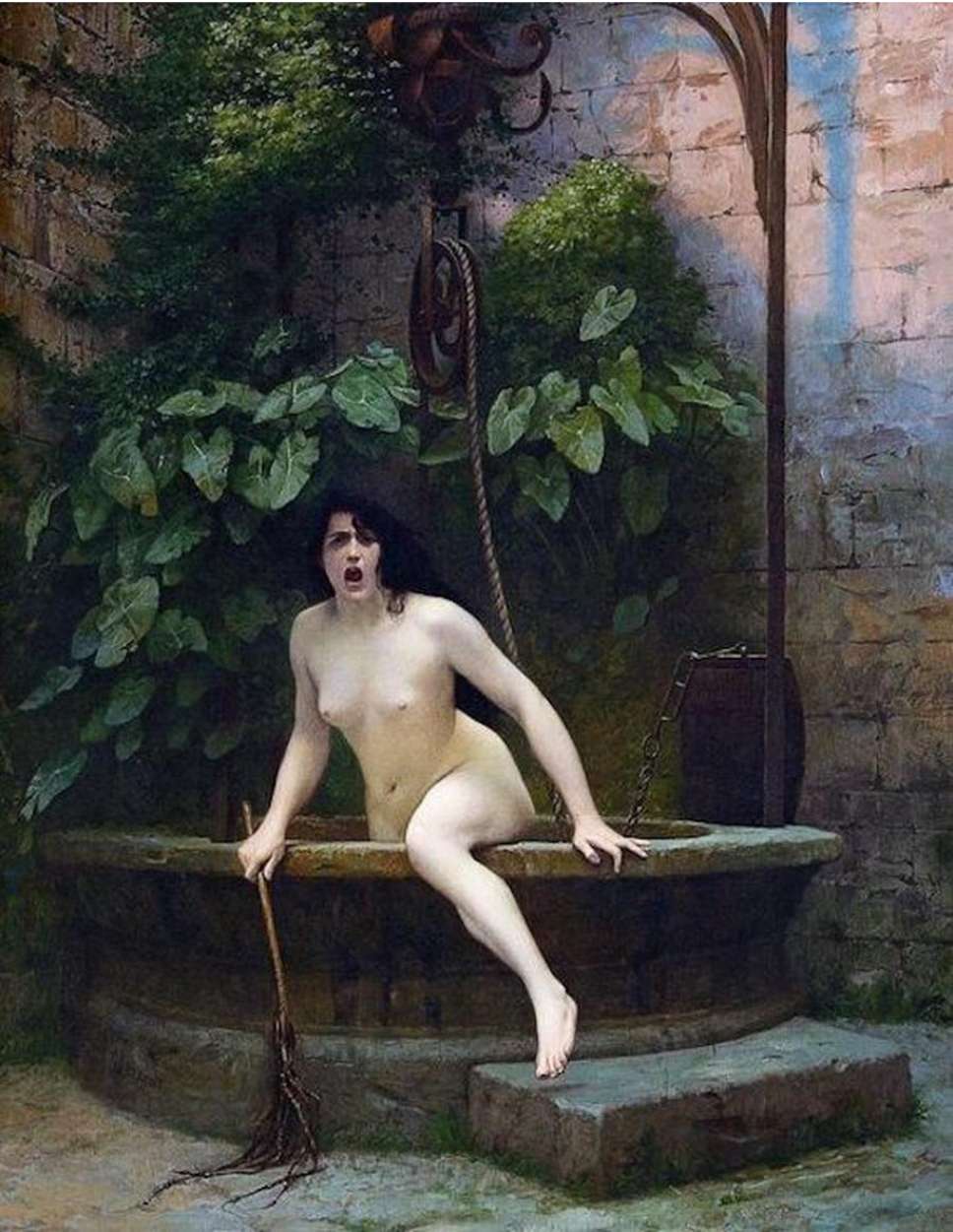Die Menschenwürde ist antastbar; die Gewaltenteilung auch.
Als der Begriff der „Menschenwürde“ vom Parlamentarischen Rat in Art. 1 Abs. I Grundgesetz verankert wurde, standen die Autoren unter dem Eindruck der Grauen des Krieges und der nationalsozialistischen Verbrechen. Nie wieder sollten Menschen ohne Gerichtsurteil in Lager gesperrt, zu Arbeitsdiensten gezwungen, gefoltert, aufgrund einer Gruppenzugehörigkeit als minderwertig bezeichnet oder für medizinische Experimente missbraucht werden.
Das kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Begriff der „Würde“, wie so viele andere Begriffe in unseren Gesetzen und Verordnungen, auslegungsfähig ist. Die aktuelle Diskussion um Frauke Brosius-Gersdorf, die von der SPD für das Amt einer Bundesverfassungsrichterin vorgeschlagen wird, hat die öffentliche Aufmerksamkeit auf diese Problematik gelenkt – nicht nur auf die Frage nach der „Würde“, sondern auch danach, wie der „Mensch“ zu definieren ist.
Das Grundgesetz gibt darauf keine Antwort. Das Bundesverfassungsgericht jedoch urteilte 1993: „Menschenwürde kommt schon dem ungeborenen menschlichen Leben zu“. Davon unbeeindruckt schrieb Brosius-Gersdorf 2024: „Die Annahme, dass Menschenwürde überall gelte, wo menschliches Leben existiert, ist ein biologistisch-naturalistischer Fehlschluss.“
Wenn freilich dieser Schritt der Relativierung einmal getan ist, nicht mehr jedem Menschen Menschenwürde zuzugestehen, ist einer immer weiteren Verschiebung der Grenze Tür und Tor geöffnet. Kleinkinder? Behinderte? Ungeimpfte? AfD-Wähler?
Brosius-Gersdorf geht aber noch weiter: „Menschenwürde und Lebensschutz sind rechtlich entkoppelt“, sagt sie, und: „Die Tötung eines Menschen ohne herabwürdigende Begleitumstände, die ihm seine Subjektqualität absprechen, verletzt Art. 1 I GG nicht“.
Zugegebenermaßen sind Lebensrecht und Menschenwürde unterschiedliche Dinge, aber man muss doch fragen, ob die Menschenwürde nicht das Lebensrecht einschließt. Brosius-Gersdorfs Aussage jedenfalls klingt, als wäre eine neuer, „sauberer“ Faschismus im Anzug, der jederzeit bereit ist, die schmutzigen Konzentrationslager von einst, in denen mehr Menschen an Krankheiten starben als durch Mord, durch klinisch reine Tötungslager zu ersetzen – etwa um AfD-Anhänger zu „beseitigen“; sagte doch Brosius-Gersdorf mit offensichtlichem Bedauern, bei einem Verbot der AfD sei deren „Anhängerschaft nicht beseitigt“. Dazu passt auch, dass sie sich während der „Pandemie“ für eine allgemeine Impfpflicht aussprach – ein medizinisches Experiment, das weltweit viele Millionen Menschen die Gesundheit oder sogar das Leben gekostet hat.
Freilich bietet sich der Begriff der „Menschenwürde“ neben der Relativierung auch für das Gegenteil an: seine inflationäre Nutzung und seinen Missbrauch, um politische Ziele durchzusetzen. Hierbei hat sich das Bundesverfassungsgericht im Jahr 2022 bereits hervorgetan, indem es Art. 1 I GG als Begründung für einen „Leistungsanspruch“ gegenüber dem Staat, „im Fall der Bedürftigkeit materielle Unterstützung zu erhalten“ heranzog, und das nicht nur für deutsche Staatsbürger. Das Abwehrrecht gegen staatliche Übergriffe wurde in ein Anspruchsrecht gegenüber der steuerzahlenden Bevölkerung umgedeutet, und zwar in einer Höhe, die bei objektiver Betrachtung über das „Existenzminimum“ weit hinausgeht. Dabei sollte dieser Begriff eigentlich kaum dehnbar sein, denn er bedeutet das Geringstmögliche, um das Überleben zu sichern. Eine vergleichbare Entwicklung zu Anspruchsrechten auf Kosten Anderer ist bei den sogenannten „Menschenrechten“ der UN zu beobachten.
Dabei drängt sich doch die Frage auf, ob es mit der Menschenwürde vereinbar ist, die Steuer- und Abgabenzahler zu zwingen, für nicht arbeitende und nicht einzahlende Menschen jeglicher Herkunft aufzukommen – ja, ob es mit der Menschenwürde der Empfänger vereinbar ist, auf Kosten Anderer zu leben. Oder auch, ob es mit der Menschenwürde vereinbar ist, wenn die Regierenden das Volk, von dem laut Grundgesetz bekanntlich die Staatsgewalt ausgeht, mit detaillierten Vorschriften bis in die persönliche Lebensführung hinein wie Untertanen oder unmündige Kinder behandeln.
Ein eindeutig politisches Urteil des Bundesverfassungsgerichts war auch das sogenannte Klimaschutzurteil von 2021, in welchem sich die Richter in einem wissenschaftlich unklaren und umstrittenen Thema politisch positionierten. Besonders brisant war dabei, dass eine der Richterinnen mit einem Politiker der Grünen verheiratet ist und Formulierungen von dessen Netzseite fast wörtlich in das Urteil übernahm. Da ist es schon eine kuriose Inzidenz, dass eine solche eheliche Zusammenarbeit auch Frauke Brosius-Gersdorf vorgeworfen wird, in deren Dissertation sich Passagen aus der Habilitationsschrift ihres Mannes finden (oder umgekehrt – derzeit noch eine ungeklärte Frage, da beide Arbeiten im selben Jahr eingereicht wurden). Es war denn auch dieser Umstand, nicht etwa die politisch einseitige Haltung der Kandidatin, der zur Verschiebung der Richterwahl geführt hat.
Wenn das Bundesverfassungsgericht, wie es in einem Rechtsstaat sein müsste, politisch unabhängig wäre, würden sich solche Diskussionen, ja Streitereien um seine Besetzung erübrigen. Es ist ein Unding, dass Politiker diejenigen wählen, welche die Aufgabe haben, sie zu kontrollieren. Verfassungsrichter dürften keiner Partei oder politischen Interessengruppe angehören und müssten sich alleine durch ihre Erfahrung und die Qualität ihrer früheren Urteile, die sich daran messen ließe, wie selten sie durch eine höhere Instanz revidiert wurden, qualifizieren. Es ist allzu durchsichtig, wie die SPD durch ihre Kandidatinnen (neben Brosius-Gersdorf ist es die Klimaaktivistin und Enteignungsbefürworterin Ann-Katrin Kaufhold) darauf hinarbeitet, Abtreibungen bis zur Geburt, ein AfD-Verbot und wohl auch andere linke Projekte, die nach herkömmlicher Auffassung verfassungswidrig wären, durchzusetzen. Eine echte Gewaltenteilung gab es in der Bundesrepublik nie (siehe auch die Weisungsgebundenheit der Staatsanwaltschaften!).
Aber zurück zum Begriff der „Menschenwürde“: Wenn dieser einerseits so eng gefasst werden kann, dass er die Tötung eines Menschen erlaubt, und andererseits so weit, dass sich Umverteilungswünsche und Anspruchsdenken damit begründen lassen – was ist er dann noch wert?
Er müsste durch einen objektiv bestimmbaren Grundsatz ersetzt werden. Wie wäre es mit: „Leben, Gesundheit und Eigentum des Menschen sind unantastbar“?
Das würde freilich den Politikern einiges an Macht nehmen. Steuern wären dann nicht möglich – der Staat müsste sein Geld durch direkten Verkauf seiner Dienstleistungen, deren Nutzung freiwillig wäre, generieren und sich mit einem wesentlich geringeren Budget begnügen. Das wäre auch ohne weiteres möglich, wenn er sich auf seine Kernaufgaben, nämlich die Gewährung innerer und äußerer Sicherheit, beschränkte.
Doch eine solche Ordnung, die im Gegensatz zu „unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung“ wirklich „freiheitlich“ genannt werden könnte, ist von der Mehrheit der Wähler nicht gewünscht, weil sie, bei nur 15 Millionen „Nettosteuerzahlern“ (das sind diejenigen, die mehr an den Staat bezahlen als sie zurückerhalten), vom gegenwärtigen System zu profitieren scheinen. Ich sage „scheinen“, weil der allgemeine Wohlstand in einem freiheitlichen System, das keine Anreize zum Müßiggang setzt und Leistung nicht bestraft, ungemein höher wäre.
Freie, gleichberechtigte Bürger, die ihr Leben selbstbestimmt führen können und für ihr Handeln und ihre Entscheidungen selbst verantwortlich sind, benötigen keine staatliche Garantie einer „Menschenwürde“, die von Herrschenden je nach Gusto interpretiert und sogar missbraucht werden kann, also letztlich irrelevant ist. Gegen jegliche Übergriffe geschützt zu sein, grade auch gegen die des Staates: Das ist die wahre Menschenwürde.
Paypal-Spende | Patreon-Spende
Herzlichen Dank!